

Geschichtliche Entwicklung
Deutschland hieß nach dem verlorenen 1. Weltkrieg «Deutsches Reich»
und erlebte eine Blütezeit in den «Goldenen Zwanziger»-Jahren.
Das Eisenbahnnetz war beinahe komplett und die Großstädte des Deutschen Reiches,
allen voran Berlin und Hamburg, wuchsen zu ungeahnter Größe heran.
Doch damit nahmen in diesen Städten auch die Verkehrsprobleme zu.
Die 1920 gegründete Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) nahm eine elektrische "Stadtschnellbahn"
in Betrieb, die ihren Strom von einer seitlich neben den Schienen angebrachten Stromschiene erhielt.
Auf diesen mit 800 Volt (Berlin) bzw. 1200 V (Hamburg) ausgerüsteten Strecken erhielten die nun ausschließlich als Triebwagen
gefahrenen Stadtschnellbahn-Züge ihren (Gleich-)Strom, der durch die Fahrschienen wieder zurückfloß.
Sie erreichten eine höhere Geschwindigkeit, hatten eine größere Anfahrbeschleunigung
und eine stärkere Bremskraft als die bisher mit Dampfloks gefahrenen Vorortzüge.
Dies wiederum erlaubte eine höhere Taktfolge (bis hinab zu weniger als zwei Minuten);
außerdem verlängerte man die Bahnsteige und Zuglängen.
Dadurch erreichte man eine höhere Beförderungskapazität.
Mehr Fahrgäste in der gleichen Zeit konnten nun durch die
elektrischen Stadtschnellbahn-Züge befördert werden.
Außerdem wurden neue Strecken errichtet, wie die neue unterirdische Verbindung durch Berlin.
Doch nur in den Großstädten Berlin und Hamburg war vor dem Zweiten Weltkrieg
ein leistungsfärhiges S-Bahn-Netz aufgebaut worden. Für das Rhein-Ruhr-Gebiet hatte man
zwar den Rhein-Ruhr-Schnellverkehr geschaffen, allerdings lediglich mit Dampfzügen und preußischen Abteilwagen.
Und in München hatte man zwar noch 1938 angefangen einen Tunnel zu graben,
doch der inzwischen begonnene Krieg und setzte diesem Vorhaben (und nicht nur diesem!) ein Ende.
Und für die übrigen Städte Deutschlands war schon gar nichts Derartiges vorgesehen.
Nach dem verlorenen Krieg waren die meisten deutschen Städte zerbombt und vielfältig zerstört.
Das Leben kam nur langsam wieder in Gang. Die Sorgen und Probleme waren dabei Andere.
Außerdem wurde Deutschland von etwa 1948 an geteilt. (Und blieb es bis Ende 1990.)
Im Westen Deutschlands wurde 1949 die Bundesrepublik Deutschland (BRD) gegründet,
und in der Mitte Deutschlands etablierte sich die Deutsche Demokratische Republik (DDR).
während der Osten schon von 1945 an unter polnische sowie sowjetische Verwaltung (so die offizielle Sprachregelung) an gestellt wurde.
Der Osten Deutschlands hingegen wurde durch die UdSSR schon von Mitte 1945 (?) unter die sowjetische Verwaltung gestellt,
bzw. der grösste Teil eigentlich unter die polnische Verwaltung, während der Osten Polens durch die UdSSR abgeknappst wurde.
Aber nicht nur dort: Auch das Saarland wurde durch Frankreich vom bestehenden deutschen Staatsgebiet separiert
und dort eine autonome, Frankreich willfährige Regierung installiert.
Vor allem wurde von der westdeutschen Regierung der Straßenverkehr massiv gefördert (durch Straßenbau, Autobahnen
und vermeintlich "autogerechter Innenstädte" und Anderes mehr).
Die Deutsche Bundesbahn jedoch musste ihre sämtlichen Reparatur-Maßnahmen an Brücken, Tunnel, Bahnhöfen
ihre sämtlichen Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen aus eigener Tasche bezahlen.
Eine schlechte und völlig falsche Verkehrspolitik, die die Bundesregierung unter Adenauer betrieb. und insbesondere ihr langjähriger
Verkehrsminister Seebohm verfolgte und die sich dann Ende der Sechziger und Anfang der Siebziger Jahre rächen sollte.
Ein Verkehrskollaps in den westdeutschen Städten war absehbar, der ab den 60-er Jahren massiv zutage trat.
Nun mußten die Städte dafür eine Lösung finden. Und Eines wurde auch klar :
Eine "autogerechte" Stadt konnte es nicht geben und gibt es auch heute nicht !
Nur Schienenverkehrsmittel waren und sind in der Lage, ein Tausendfaches an Personen in der gleichen Zeit
und auf einem Minimum an Verkehrsflächen zu befördern.
Und so gab es zwei Möglichkeiten für dieses Problem :
1. Die vorhandenen Straßenbahnen in den Stadtzentren unterirdisch als
U-Bahn oder "Unterpflasterstraßenbahn" zu führen
2. Vorhandene Eisenbahnentrassen im Umland der Städte auszubauen
und als "S-Bahn" zu betreiben.
Die Deutsche Bundesbahn war, was den zweiten Punkt betraf, dazu bereit.
Allerdings hatte man die Elektrifizierung des Schienennetzes in Westdeutschland mit Oberleitung 15 KV 16⅔ Hz Wechselstrom
bereits massiv vorangetrieben. Daher erschien es unsinnig, die weiteren Ausbaumaßnahmen mit einem
anderen Stromsystem (wie bspw. in Berlin u. Hamburg mittels einer Stromschiene) durchzuführen.
Die Städte mit den vordringlichsten Problemen waren München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Essen, Köln und Stuttgart.
Außerdem waren die 20. Olympischen Spiele im Jahre 1966 nach München vergeben worden,
sodaß hier ein ganz besonderer Zeitdruck bestand.
Man beschloß also, die neu zu schaffenden S-Bahn-Systeme mit dem vorhandenen Stromsystem zu realisieren.
Doch einen geeigneten Triebzug dafür gab es nicht. Er mußte erst entwickelt werden.
Und so wurde von der Deutschen Bundesbahn die Entwicklungs-Arbeiten für den ET27 in Auftrag gegeben,
der dann 1964 in fünf Exemplaren gebaut wurde.
Er gilt als Vorläufer des 420.
Die wichtigsten technischen Daten des ET27 (ab 01.01.1968 "427" genannt) :
Dreiteilige Fahrzeug-Konfiguration mit zwei angetriebenen Endwagen
(mit jeweils einem Führerstand) und einem antriebslosen Mittelwagen
Einsatz nur als zwei- oder drei-teiliges Fahrzeug
Niedrige Fußbodenhöhe von nur 1000 mm
Schiebetüren mit Unterstützung beim Öffnen und zentral vom Führerstand aus gesteuertes Schließen
Durch die niedrige Fußbodenhöhe mußten die meisten technischen Geräte und Anlagen auf dem Dach untergebracht werden.
entwickelt und ab 1968 in drei Exemplaren als Prototypen gebaut und von 1969 bis 1970 abgeliefert.
Da die Farbgebung noch unklar war, wurde jeder der drei Prototypen mit einer anderen Farbe versehen,
wobei als Grundfarbe nur das Weiß feststand. Offiziell heißt der Farbton "Kieselgrau" : RAL 7032.
Die drei dazu ausgewählten Farben entstammen allesamt der "Popfarben-Ära" und wurden vom
1971 geschaffenen Design-Center der Dt. Bundesbahn ausgewählt.
Dieses Design-Center war beim BZA (Bundesbahn-Zentralamt) in München angesiedelt und sollte frischere, modernere Farben
für das Unternehmen aussuchen und festlegen. Auch die im Jahre 1971 sogenannten "Pop-Wagen"
gehörten dazu; und es war sicher kein Zufall, daß die Farbgebung der 420-er denen der "Pop-Wagen" glich.



In welchen Farben die Triebzüge lackiert werden sollten, darin wollte man sich nicht festlegen.
Man überließ ganz einfach der Bevölkerung die Entscheidung und organisierte hierfür entsprechende
Abstimmungen, als die neu geschaffenen Triebzüge der Bevölkerung vorgestellt wurden.
Diese Haltung entsprach ganz dem durch den Bundeskanzler Willy Brandt ausgegebenen
Slogan «Mehr Demokratie wagen».
Folgende Abstimmungen wurden im Rahmen von Fahrzeug-Präsentationen für die Öffentlichkeit durchgeführt :
| Ort | Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| A. | München | vom 28.02. bis 01.03.1970 | Entscheidung für Blau-Weiß |
| B. | Düsseldorf | vom 03.03. bis 04.03.1970 | Entscheidung für Orange-Weiß |
| C. | Frankfurt am Main | am 05.03.1970 | Entscheidung für Weinrot-Weiß |
Weitere Präsentationen fanden im Ruhrgebiet statt, möglicherweise auch in Stuttgart.
Allerdings sind von diesen Orten keine Abstimmungen bekannt oder überliefert.
Aufgrund der im August 1972 beginnenden 20. Olympischen Sommerspiele hatte die Serienlieferung sehr rasch zu erfolgen
und so blieb keine Zeit für eine ausgiebige Erprobung. Es sollten wenigstens 120 Einheiten für den Sommerfahr-
plan 1972 zum 28.05.1972 zur Verfügung stehen. Dieses Ziel wurde in beeindruckender Weise erreicht.
| S1 | Freising | M-Laim | «Stammstrecke» | M Ostbahnhof | Hohenbrunn |
| S2 | Petershausen | M-Laim | «Stammstrecke» | M Ostbahnhof | Deisenhofen |
| S3 | Maisach | M-Pasing | «Stammstrecke» | M Ostbahnhof | |
| S4 | Geltendorf | M-Pasing | «Stammstrecke» | M Ostbahnhof | Ebersberg |
| S5 | Herrsching | M-Pasing | «Stammstrecke» | M Ostbahnhof | |
| S6 | Tutzing | M-Pasing | «Stammstrecke» | M Ostbahnhof | Erding |
auch die Linie
| S11 | M-Olympiastadion (Oberwiesenfeld) | M-Pasing | «Tunnel-Stammstrecke» | M Ostbahnhof |
vollständig mit Vollzügen bestückt gefahren werden.
Die Linie S10 München Holzkirchner Bf - Wolfratshausen wurde noch viele Jahre lang weiterhin mit den
"Silberlingen", gezogen von einer 141-er im Wendezug-Betrieb, gefahren.
Und auch die Teilabschnitte
Hohenbrunn - Kreuzstraße (S1)
Deisenhofen - Holzkirchen (S2)
M Ostbahnhof - Ismaning (S3)
wurden zunächst nicht in das S-Bahn-Netz integriert.
Die Abschnitte der S1 und S2 wurden entweder mit Schienenbussen oder Silberlingen befahren,
der Abschnitt M Ostbahnhof nach Ismaning, vorgesehen für die Linie S3, sogar vollständig mit Bussen bedient.
Auch auf wichtige Zwischenzüge zur Verdichtung des 40- auf einen 20-Minuten-Takt musste
entweder verzichtet werden oder konnten zunächst nur mit Kurzzügen gefahren werden.
Dies änderte sich aber im Laufe der Jahre 1973 bis 1976, als immer mehr der bestellten
200 Garnituren der 1. und 2. Bauserie zur Verfügung und im Einsatz standen.
Trotz der viel zu kurzen Erprobungszeit und der rasch zu erfolgenden Lieferung der
Serienzüge (1. Bauserie) bewährten sich die Garnituren hervorragend.
Ihre rasche Anfahr-Beschleunigung, die durch Druckluftbetätigung sich rasch öffnenden und schließenden Schiebetüren
und ihr elegantem Aussehen, einem Weißton mit blauem Farbband um die Fenster im Stile der bayerischen Landesfarben,
zusammen mit dem eleganten Stirnfront der Triebzüge,
daß sich zudem wohltuend vom damaligen Bundesbahn-Einheitsgrün abwich, gewannen die
S-Bahn-Triebzüge der Baureihe 420 sehr rasch große Beliebtheit bei der Münchener Bevölkerung.
Und nicht nur dort:
Schon ab November 1972 kamen die ersten orange-weißen Einheiten auch nach Düsseldorf
und dann zwischen Essen und Langenfeld zum Einsatz.
Die zur Erödes Frankfurter Flughafen am 14. März 1972 von München ausgeliehenen
blau-weißen Einheiten 420 020 u. 420 067
Diese gaben allerdings nur für den Tag der Eröffnung ein kurzes Gastspiel.
Der reguläre Verkehr wurden dann mit Silberlingen, gezogen/geschoben von Elektroloks der BR 141
sowie den damals völlig neu gestalten Steuerwagen BDnrzf 740.
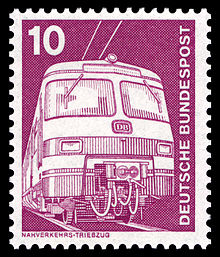
So wurden bald folgende Mängel offenbar :
Dezember 1973 : Durch Schnee, Flugschnee und Minustemperaturen gelangt Schnee in die Taschen der Schiebetüren,
der dort dann festfriert. Die Türen können dadurch bedingt nicht mehr vollständig öffnen.
Auch konnte man im Laufe der ersten Jahre des S-Bahn-Betriebes in München feststellen,
daß durch die Abwärme der Leistungselektronik in den Triebwagen die unterirdischen S-Bahn-Stationen
auch im Winter gut gewärmt" wurden.
Doch diese Mängel bzw. Kinderkrankheiten, die wohl jedes Fahrzeug (und technische Gerät) hat,
wurden bald behoben und konnten den Erfolg dieses Triebwagens nicht schmälern.
Außerdem bekam der ET420 nach nur 5 Jahren schon ein Pendant:
Es war der von ihm abgeleitete Gleichstrom-S-Bahn-Triebzug ET472, der sich im Konzept sehr ähnelte,
aber aufgrund des Gleichstrom-Einsatzes bei der S-Bahn Hamburg anstatt Einholmstromabnehmern
an den Endwagen beidseitig Drehgestell-Stromabnehmer erhielt, die auch eingezogen werden können.
Außerdem ist der Mittelwagen BR 473 vollständig mit der 1.Klasse, wie dies auch bei den bereits im Einsatz stehenden
Fahrzeugen der BR 471/871 und BR 470/870 der Fall ist.
Allerdings wurde die Kopf-Form neu gestaltet und dessen Farbgebung den inzwischen geänderten Design-Vorstellungen der Deutschen Bundesbahn
angepasst und in den Farben ozeanblau/beige lackiert. Ozeanblau im oberen Bereich der Fenster, beige im unteren Bereich,
also genau umgekehrt als bei den Schnellzugwagen der DB-Schnellzüge.
Erforderlich waren diese S-Bahn-Triebzüge für die Inbetriebnahme der sogen. City-S-Bahn, die vom Hamburger Hauptbahnhof
unter der Alster zu den neu errichteten Stationen Jungfernstieg, ..., und bis zu den Landungsbrücken 1974 in Betrieb genommen wurde.
Die Lieferung eines ersten Bauloses von 30 Garnituren erfolgte zeitgleich zur Inbetriebnahme dieses neuen Teilstücks der Hamburger S-Bahn 1974.

| Baujahre | Fz.Nummer von - bis | Bau- serie | Anzahl Fahrzeuge | Farbe(n) | Bemerkungen/Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1969 - 02.1970 | 420 001 bis 420 003 | 0. | 3 | (siehe oben) | |
| 12.1970 - 08.1972 | 420 004 bis 420 120 | 1. | 117 | bw | |
| 07.1972 - 12.1975 | 420 121 bis 420 200 | 2. | 80 | ow, bw | |
| 11.1976 - 06.1978 | 420 201 bis 420 260 | 3. | 60 | ow | |
| 01.1979 - 05.1979 | 420 261 bis 420 324 | 4. | 64 | ow | |
| 05.1979 - 08.1980 | 420 325 bis 420 370 | 5. | 46 | ow | |
| 08.1980 - 07.1981 | 420 371 bis 420 390 | 6. | 20 | ow | |
| 10.1989 - 03.1993 | 420 400 bis 420 430 | 7. | 31 | ow | Einige in Munic-Airport-Lackierung |
| 12.1993 - 10.1997 | 420 431 bis 420 489 | 8. | 59 | ow | Schwenkschiebetüren |
Bemerkenswert ist, daß diese Triebwagen von 1969 bis 1997 - mithin also über einem Zeitraum
von 28 Jahren (!) fast unverändert gebaut wurde.
Es gibt nur wenige Triebfahrzeug-Bauarten, die einen ebensolchen Rekord aufweisen (können).
Darüber hinaus wurden in den 1980-er und 1990-er Jahren weitere Mittel- sowie einige Endwagen separat
nachgebaut, um vorhandene unvollständige Fahrzeuge wieder zu einer vollständigen Einheit zu komplettieren.


(Buch) S-Bahn München, alba-Verlag, Düsseldorf 1997, Autoren: Pospischil, Reinhard u. Rudolph, Ernst, ISBN 3-87094-358-0
ET420-Online Eine Webseite von Dirk Mattner mit ständig aktuellen Informationen über den Triebzug ET420
Wikipedia DB-Baureihe 420.html
Gestaltung dieser Webseite & verantwortlich für den Inhalt:
©  @
@  , Wüstems bei Glashütten 2011
Letzte Aktualisierung: 2017-12-06
, Wüstems bei Glashütten 2011
Letzte Aktualisierung: 2017-12-06